 Dance and Wellbeing – Tanz und Wohlbefinden – ist ein Begriff aus der Community Dance-Szene, die sich seit den 1970er Jahren in Großbritannien entwickelt hat. Tanz in Schulen, in Jugendzentren, in Gefängnissen, Krankenhäusern, mit behinderten und alten Menschen war dort seit den 1970er Jahren gängige Praxis.
Dance and Wellbeing – Tanz und Wohlbefinden – ist ein Begriff aus der Community Dance-Szene, die sich seit den 1970er Jahren in Großbritannien entwickelt hat. Tanz in Schulen, in Jugendzentren, in Gefängnissen, Krankenhäusern, mit behinderten und alten Menschen war dort seit den 1970er Jahren gängige Praxis.
Community Dance ist „Tanz mit einem sozialen Zweck“– „dance with a social purpose”– und bezieht sich auf partizipative Formate, von Workshops bis zu Performances. Die Philosophie dieser Bewegung ist geprägt von Werten wie Inklusion, Gleichwertigkeit und Vorurteilsfreiheit. Die Überzeugung, dass jeder Mensch ein Künstler (Joseph Beuys, 1921-1986) bzw. ein Tänzer (Rudolf Laban, 1879-1958) ist, bilden die Grundlage. Oder um mit Bansky zu sprechen: “Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable.”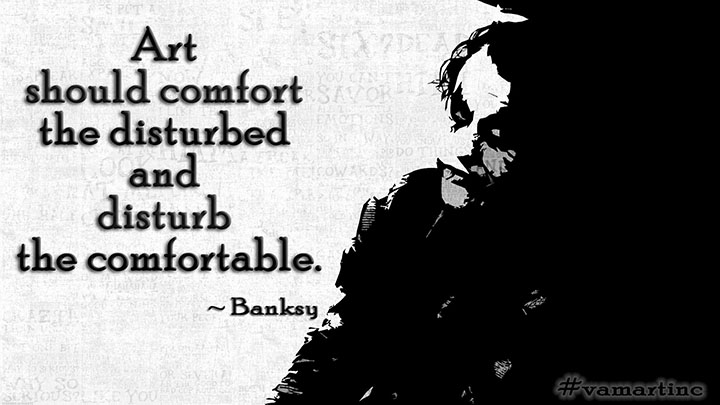
Damit der Tanz seinen weithin kolportierten Feel-Good-Effekt entfalten kann, musste er eine Reihe von Voraussetzungen, die mit dem professionellen Theatertanz verbunden sind überwinden, etwas Alter, sozialer Background, ethnische Zugehörigkeit, Gender, Aussehen, körperliche Voraussetzungen und hoch trainierte Tanzfertigkeiten. Das Überwinden dieser Stigmata hatte eine enorme Breitenwirkung und Partizipation von Laien zur Folge. In diesem Sinne baut Community Dance auf die Fähigkeiten, die die TeilnehmerInnen mitbringen.
Seit sich auch die Wissenschaft für die Wirkung des Tanzens auf den Menschen zu interessieren begann, erlebt die partizipative Kunstform einen neuen Boom. Wohlbefinden, Wellbeing und Wellness implizieren dabei einen therapeutischen Nutzen des Tanzes.
 Tanzen als Gesundheitsförderung
Tanzen als Gesundheitsförderung
Die neue „Sichtbarkeit von Community Arts und partizipativen Kunstschaffens als Alternative zur hochmodernen Kunstpraxis und dem romantischen Erbe des einzelnen Künstlers“ führt Petra Kuppers, Community-Performance-Künstlerin, Aktivistin für Behinderten-Kultur und Wissenschaftlerin, in dem erneuten Interesse der Sozialtheorie an Fragen der Gemeinschaft.
Doch auch andere Wissenschaften finden seit der Jahrhundertwende im Tanz einen lohnenswerte Forschungsbereich. Mittlerweile gibt es über dessen Wirkung eine Reihe von Studien aus biochemischer, neurokognitiver und psychosozialer Sicht.
Einen Meilenstein in der Forschung über Tanz setzten die Neurowissenschaften. 2011 erschien das Buch „The Neurocognition of Dance“, in dem Forschungsarbeiten über die Wirkung von Tanz auf das Gehirn vorgestellt werden. Die kognitiven Strukturen beim Tanzen werden aus akademischer und tänzerischer Perspektive erläutert, die vorgestellten Studien widmen sich unter anderen den neuronalen Mechanismen beim Tanzen, oder beim Zusehen, wenn das Phänomen der „Spiegelneuronen“ quasi bewirkt, dass das (meist sitzende) Publikum bei Tanzaufführungen „mittanzt“.
Vorläufiger Höhepunkt der wissenschaftlichen Tanz-Publikationen ist das 2018 erschienene „Oxford Handbook for Dance and Wellbeing“ der Oxford University Press, das mit einer Sammlung von Beiträgen aus Theorie und Praxis den derzeitigen Forschungsstand in unterschiedlichen Wissensgebieten auf etwa tausend Seiten bündelt. Darin werden unterschiedliche Settings, in denen Community Dance-Interventionen stattfinden, von Schulen bis zu Krankenhäusern und Hospizen, sowie eine Vielfalt von Strategien und Methoden beleuchtet.
Großen Impakt erzielt etwa die Tanzarbeit mit älteren Menschen, im Speziellen mit jenen, die an einer neurodegenerativen Krankheit leiden. Auslöser für die weite Verbreitung für Parkinsonkranke war die Initiative „Dance for PD®“ (Tanz für Parkinsonkranke) der Mark Morris Dance Company in New York (). Das Angebot an Dance for PD®-Tanzstunden ist in den USA nahezu flächendeckend und auch vierlorts in Großbritannien, Australien und in den Niederlanden zu finden.
In diesem Zusammenhang suchen die meisten (klinischen) Studien nach spezifischen therapeutischen Resultaten, messen die Verbesserung von Balance, Fallrisiken oder funktioneller Beweglichkeit.
Ein Jahr nach dem „Oxford Handbook of Dance & Wellness“ erschien übrigens das „Oxford Handbook of Community Music“, in dem nicht dezidiert auf Anwendungen für die Gesundheit eingegangen wird. Obwohl im institutionellen Gesundheitsbetrieb Musiktherapie eine weithin anerkannte Methode ist, scheint die künstlerische Tanzpraxis in diesem Bereich mittlerweile größere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das mag damit begründet sein, dass Tanz auch eine Bewegungsdisziplin ist, und – da ist sich die Medizin einig – Bewegung ein Schlüsselfaktor für die Vorbeugung, aber auch für die Stabilisierung oder Verbesserung von chronischen Krankheiten ist. Und das Schöne daran ist, dass es nicht nur die physische Ebene, sondern auch die emotionalen und kognitiven Kompetenzen des Menschen involviert.
 Evaluierungsmodelle
Evaluierungsmodelle
Nicht jede künstlerische Intervention, auch wenn sie über einen längeren Zeitraum läuft, kann mit akademisch-wissenschaftlichen oder klinischen Studien evaluiert werden, schon allein aus finanziellen Gründen.
Es gibt aber eine Reihe von Modellen für die Selbstevaluierung der TeilnehmerInnen und KünstlerInnen wie das dynamische Aktionsmodell „5 Ways to Wellbeing“ der New Economic Foundation oder das „Active Ingredient“-Modell von Aesop. Public Health England hat die erprobten Methoden in einer Broschüre zusammengefasst: „Arts for health and wellbeing. An evaluation framework“. Die Veränderungen bei den TeilnehmerInnen werden anhand von Surveys, qualitativen Interviews und Beobachtungen der LeiterInnen dokumentiert und ausgewertet und liefern Indizien für die Wirkungsmechanismen. Diese Methoden werden dem jeweiligen Kontext angepasst, um der komplexen Erfahrung künstlerischer Prozesse Rechnung zu tragen.
In dieser Debatte ist Sara Houstons wissenschaftliche Arbeit ein Game-Changer. Sie sieht den Tanz nicht als Werkzeug, sondern setzt ihre Untersuchungen bei den ästhetischen Werten an. In ihrem Buch „Dance with Parkinson’s“ schreibt sie: „Mein eigener Standpunkt als Forscherin war es, zu argumentieren, wie wichtig es ist, den Tanz selbst, und Tanz für Parkinson, aus verschiedenen Blickwinkeln zu untersuchen. Das Buch reflektiert dies, indem es auf der Prämisse aufbaut, dass Tanz ein komplexes soziales und kulturelles Phänomen ist. Es kann als künstlerische und kreative Aktivität sowie als eine Art Workout und manchmal auch als Therapie verstanden werden. Die Art und Weise, wie der Tanz als soziale Aktivität verwendet, präsentiert, reflektiert und wie über ihn theoretisiert wird, hat politische Konsequenzen. Das Buch hebt den Tanz für Parkinson als soziales und künstlerisches Phänomen hervor und unterscheidet sich von den meisten Forschungsstudien auf diesem Gebiet, die sich darauf als Therapie konzentrieren.“
Effekte für die Kunst
Die Öffnung für unterschiedliche Körperformen, Fertigkeiten und soziale Prägungen hat auch die professionelle Tanzwelt verändert. Performances mit AmateurtänzerInnen finden sich heute ganz selbstverständlich im Programm der etablierten Bühnen für zeitgenössischen Tanz. Aufgrund der weitreichenden Teilnahme in unterschiedlichen Kontexten, ist der partizipative Tanz heute ein integraler Teil des zeitgenössischen, künstlerischen Tanzes.
Das ist außerdem keineswegs neu, denn seitdem der Körper und dessen Ausdruck im Interesse des Tanzschaffens steht, haben immer auch Laien an dieser Kunstform aktiv partizipiert, auch in Österreich.
 Wurzeln in Österreich
Wurzeln in Österreich
Das begann Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer aus den Reformbestrebungen der Jahrhundertwende sich ableitenden Laientanzbewegung, die sich auch in Massenevents manifestierte. Rudolf von Laban hat etwa 1929 einen Gewerbeumzug auf der Ringstraße in Wien mit 2000 Mitwirkenden inszeniert. Der wegweisende Künstler und Theoretiker des Ausdruckstanzes wurde 1938 in England sesshaft, und seine Arbeit war auch für die spätere Community Dance Bewegung prägend.
Auch andere VertreterInnen des expressionistischen Tanzes Anfang des 20. Jarhhunderts können als Vorfahren des heutigen Community Dance als eine Tanzpraxis mit sozialer Zielsetzung gelten. So wandte sich zum Beispiel die Tanzschule der Suschitzky-Frauen in Wien-Favoriten an die Kinder aus Arbeiterfamilien Kinder des Bezirks, und veranstaltete mit ihren SchülerInnen diverse Aufführungen. (Heute findet man in dem Bezirk in der Anker-Brotfabrik erneut soziale Kunstprojekte wie Tanz die Toleranz oder Superar.) Die Wienerin Hilde Holger wurde in London eine Pionierin für den inklusiven Tanz mit behinderten Menschen.
Österreich hat Aufholbedarf
Das Nazi-Regime und der zweite Weltkrieg vernichteten weitreichend und nachhaltig die historischen Tanzspuren. Heute hat Österreich, sowohl in der Praxis als auch in der Diskussion um die Rolle von Kunst im Gemein- und Gesundheitswesen gegenüber Großbritannien, den Niederlanden oder den skandinavischen Ländern, aber auch gegenüber Frankreich oder Italien einen enormen Nachholbedarf. Kunst ist hierzulande noch immer nicht in seiner sozialen Funktion erkannt und anerkannt. Zwar bieten die Institutionen wie Theater und Museen zahlreiche Vermittlungsprogramme, doch steht bei diesen meist der Marketing-Aspekt im Mittelpunkt. Interventionen für gesellschaftliche Veränderungen werden von Kulturinstitutionen nur in seltenen Fällen angeboten. Kulturelle Bildungsprogramme beziehen sich vorwiegend auf die Arbeit in Schulen bzw. mit Kindern und Jugendlichen.
 Aufgrund des hochkulturellen Selbstverständnisses der hiesigen Institutionen fehlt in der „sozialen Kunstpraxis“ die driving force der großen Player. Sara Houston hat etwa ihre bahnbrechende Forschung über die Arbeit des English National Ballet mit Parkinson-Kranken durchgeführt. Wie viele britische Kunstorganisationen, die öffentliche Mittel erhalten, hat auch diese große Tourneecompagnie den kulturpolitischen Auftrag, Outreach-Programme zu erstellen. Dieses Projekt der wöchentlichen Tanzklassen mit Parkinson-PatientInnen in einer gewichtigen Kulturinstitution und die Zusammenarbeit mit einer akademischen Recherche, geht weit über die üblichen Kulturvermittlungs- oder kulturellen Bildungsangebote hinaus. Auch alle anderen großen und mittleren Tanz- und Ballettcompagnien engagieren sich in vielfältigen Community-Projekten. Das Royal Ballet etwa hat regelmäßige Klassen für sehbehinderte Kinder.
Aufgrund des hochkulturellen Selbstverständnisses der hiesigen Institutionen fehlt in der „sozialen Kunstpraxis“ die driving force der großen Player. Sara Houston hat etwa ihre bahnbrechende Forschung über die Arbeit des English National Ballet mit Parkinson-Kranken durchgeführt. Wie viele britische Kunstorganisationen, die öffentliche Mittel erhalten, hat auch diese große Tourneecompagnie den kulturpolitischen Auftrag, Outreach-Programme zu erstellen. Dieses Projekt der wöchentlichen Tanzklassen mit Parkinson-PatientInnen in einer gewichtigen Kulturinstitution und die Zusammenarbeit mit einer akademischen Recherche, geht weit über die üblichen Kulturvermittlungs- oder kulturellen Bildungsangebote hinaus. Auch alle anderen großen und mittleren Tanz- und Ballettcompagnien engagieren sich in vielfältigen Community-Projekten. Das Royal Ballet etwa hat regelmäßige Klassen für sehbehinderte Kinder.
Für eine Veränderung des Kultur- und Bildungsauftrages in Kulturinstitutionen könnte einerseits der Gesetzgeber Maßnahmen setzen oder, andererseits, die Zeit für einen inklusiveren Kulturbegriff arbeiten lassen. So hat etwa die Geschäftsführung des Wiener Staatsballetts Offenheit für die Community-Arbeit signalisiert und bereits einige Workshops (mit Andrew Greenwood) für die Weiterbildung von Ensemble-Mitgliedern für die soziale Tanzarbeit mitveranstaltet.
Auch gibt es im Gesundheitswesen bereits vereinzelte Tanzangebote, zum Beispiel in Altersheimen oder mit Parkinson-Selbsthilfegruppen, die jedoch Pilotprojekte bleiben. Aber: es fehlt eine Vernetzung. Es braucht eine Vermittlungsstelle. Im Gegensatz zur Praxis in Österreich, wurden etwa in Großbritannien Strukturen geschaffen, die die partizipativen Angebote einerseits verwalteten, und andererseits die einzelnen Aktivitäten auf diesem Gebiet vernetzte. Die Organisation Shape etwa wurde von Gina Levete ins Leben gerufen, einer der Pionierinnen für inklusiven Tanz, und fungierte bereits zu Beginn der Community Dance Bewegung als Agentur zwischen Institutionen des Gesundheitsbereichs oder Strafvollzugseinrichtungen einerseits und KünstlerInnen andererseits. 1986 wurde das Netzwerk für Community Dance, das heute unter dem Titel „People Dancing“ firmiert, ins Leben gerufen. Von Anfang an nahm die heute etwa 5000 Mitglieder starke Organisation eine Schlüsselfunktion in kulturpolitischen Verhandlungen und bei der Strategieentwicklungen ein.
So wurde aus einer Reihe von Pilotprojekten die Community-Dance-Bewegung, die – mittlerweile auch international – ständig weiter wächst, und nun auch eine immer größere Rolle im Gesundheitswesen spielt.
Dieser Artikel ist in gekürzter Fassung in der Ausgabe 1.19 „Kultur als Rezept“ des Magazins der IG Kultur Österreich - Zentralorgan für Kulturpolitik und Propaganda erschienen.
