![]() Es sind nicht zuletzt die Tanzszenen, die in Strauss’ Operetten historische, national-regionale und soziale Konstellationen charakterisieren, die also der Couleur locale bzw. der Couleur du temps dienen und gesellschaftliche Konventionen reflektieren. Stände bzw. soziale Schichten werden über die von ihnen gepflegten Tanzformen gekennzeichnet, kulturelle Traditionen zumal volkstümlicher Ausprägung über Bezugnahmen auf tanzmusikalische Eigenheiten dieser oder jener Region aufgerufen.
Es sind nicht zuletzt die Tanzszenen, die in Strauss’ Operetten historische, national-regionale und soziale Konstellationen charakterisieren, die also der Couleur locale bzw. der Couleur du temps dienen und gesellschaftliche Konventionen reflektieren. Stände bzw. soziale Schichten werden über die von ihnen gepflegten Tanzformen gekennzeichnet, kulturelle Traditionen zumal volkstümlicher Ausprägung über Bezugnahmen auf tanzmusikalische Eigenheiten dieser oder jener Region aufgerufen.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
![]() Im Rahmen des Festjahres anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn bot die seit 2004 bestehende Veranstaltungsreihe „Tanz-Signale“ des Wiener Instituts für Strauss-Forschung (WISF) 2025 ein wissenschaftlich und künstlerisch besonders breit gefächertes Programm unter dem Stichwort „Phänomen Strauss“. Marion Linhardt widmete sich den bisher in der Forschung kaum beachteten Tanzszenen in Strauss’ Operetten. In diesen Szenen zeigt sich eine stilistische Anbindung an ein ganzes Spektrum von Tanzpraktiken zwischen historischen Gesellschaftstänzen, dem Handlungsballett des 19. Jahrhunderts und der aufkommenden Varietéästhetik.
Im Rahmen des Festjahres anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn bot die seit 2004 bestehende Veranstaltungsreihe „Tanz-Signale“ des Wiener Instituts für Strauss-Forschung (WISF) 2025 ein wissenschaftlich und künstlerisch besonders breit gefächertes Programm unter dem Stichwort „Phänomen Strauss“. Marion Linhardt widmete sich den bisher in der Forschung kaum beachteten Tanzszenen in Strauss’ Operetten. In diesen Szenen zeigt sich eine stilistische Anbindung an ein ganzes Spektrum von Tanzpraktiken zwischen historischen Gesellschaftstänzen, dem Handlungsballett des 19. Jahrhunderts und der aufkommenden Varietéästhetik.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
![]() In 2013 the BBC broadcast a programme in its popular TV series “Who Do You Think You Are?” In the series, celebrities are invited to delve into their family histories, guided by expert genealogists and subject specialists. The programme[1] featured the singer and actress Marianne Faithfull and threw a spotlight on Marianne’s late mother Eva, who had pursued a career as a dancer in Germany and Austria before the Second World War. Much new information came to light, thanks to the BBC’s researches, and more has emerged since.
In 2013 the BBC broadcast a programme in its popular TV series “Who Do You Think You Are?” In the series, celebrities are invited to delve into their family histories, guided by expert genealogists and subject specialists. The programme[1] featured the singer and actress Marianne Faithfull and threw a spotlight on Marianne’s late mother Eva, who had pursued a career as a dancer in Germany and Austria before the Second World War. Much new information came to light, thanks to the BBC’s researches, and more has emerged since.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
![]() Am 29. November 2025 gelangt in der Volksoper Wien die Märchenoperette „Aschenbrödels Traum“ von Axel Ranisch (Libretto) und Martina Eisenreich (Komposition) zur Uraufführung. In dem auf mehreren Zeitebenen angesiedelten Werk wird eine fiktive Entstehungsgeschichte des unvollendet nachgelassenen Balletts „Aschenbrödel“ von Johann Strauss geschildert. Als „heimliche“ Verfasserin des Ballettlibrettos für Strauss wird in dieser Operette die in der Wiener Literaturszene um 1900 als Stenografin und „Typewriterin“ tätige Ida Grünwald gesehen.
Am 29. November 2025 gelangt in der Volksoper Wien die Märchenoperette „Aschenbrödels Traum“ von Axel Ranisch (Libretto) und Martina Eisenreich (Komposition) zur Uraufführung. In dem auf mehreren Zeitebenen angesiedelten Werk wird eine fiktive Entstehungsgeschichte des unvollendet nachgelassenen Balletts „Aschenbrödel“ von Johann Strauss geschildert. Als „heimliche“ Verfasserin des Ballettlibrettos für Strauss wird in dieser Operette die in der Wiener Literaturszene um 1900 als Stenografin und „Typewriterin“ tätige Ida Grünwald gesehen.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
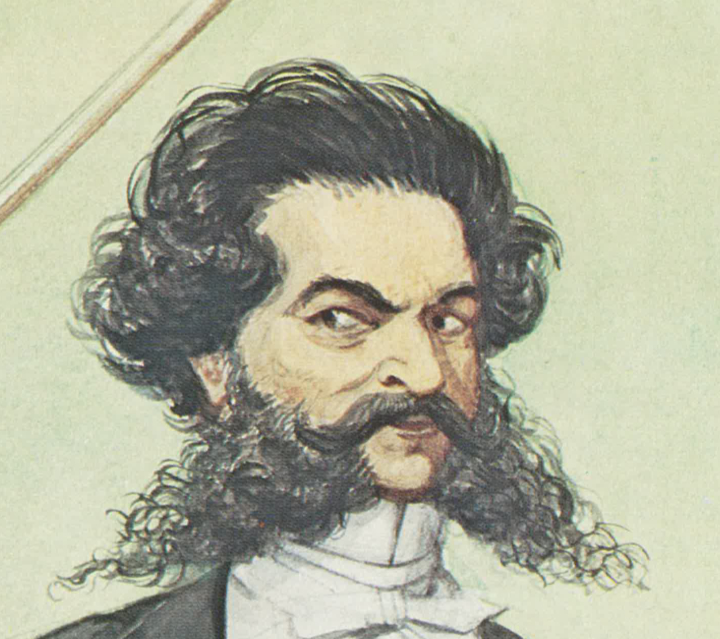 Zur Wiederkehr des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn erscheint der Aufsatzband jener Ringvorlesung „Strauss-Topographien: Klang | Raum | Wien“, die aus Anlass des Jubiläums vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien im Sommersemester 2025 abgehaltenen wurde. Das von Isabella Sommer herausgegebene Buch vereint die dabei gehaltenen Vorträge. Unter dem Titel „In den so unterschiedlichen Tanzräumen von Johann Strauss: Vor allem körperliche Bewegung!“ versucht die Autorin des Nachstehenden das – unter anderem auch – bewegungsgestaltende Phänomen Johann Strauss zu ergründen.
Zur Wiederkehr des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn erscheint der Aufsatzband jener Ringvorlesung „Strauss-Topographien: Klang | Raum | Wien“, die aus Anlass des Jubiläums vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien im Sommersemester 2025 abgehaltenen wurde. Das von Isabella Sommer herausgegebene Buch vereint die dabei gehaltenen Vorträge. Unter dem Titel „In den so unterschiedlichen Tanzräumen von Johann Strauss: Vor allem körperliche Bewegung!“ versucht die Autorin des Nachstehenden das – unter anderem auch – bewegungsgestaltende Phänomen Johann Strauss zu ergründen.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
 Seit Alessandra Ferris Amtsantritt als Direktorin des Wiener Staatsballetts am 1. September 2025 werden immer wieder Antworten auf die brennende Frage gegeben, die wievielte Frau in dieser Position sie denn sei. Schon im Vorfeld und kurz nach der ersten Vorstellung in ihrer Amtszeit konnte man wiederholt in Printmedien lesen, Alessandra Ferri sei nach Erika Hanka und Elena Tschernischova die dritte Frau in dieser Position. In einer Internet-Publikation wurde behauptet, sie habe drei Vorgängerinnen gehabt: Hanka, Tschernischova und Anne Woolliams. „tanznetz.“ aber nannte vor wenigen Tagen die Zahl Acht.
Seit Alessandra Ferris Amtsantritt als Direktorin des Wiener Staatsballetts am 1. September 2025 werden immer wieder Antworten auf die brennende Frage gegeben, die wievielte Frau in dieser Position sie denn sei. Schon im Vorfeld und kurz nach der ersten Vorstellung in ihrer Amtszeit konnte man wiederholt in Printmedien lesen, Alessandra Ferri sei nach Erika Hanka und Elena Tschernischova die dritte Frau in dieser Position. In einer Internet-Publikation wurde behauptet, sie habe drei Vorgängerinnen gehabt: Hanka, Tschernischova und Anne Woolliams. „tanznetz.“ aber nannte vor wenigen Tagen die Zahl Acht.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
![]() Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) nützt in seiner Ausstellung „Johann Strauss: Rausch und Ekstase. Feministischer Ausdruckstanz im Plakat 1900–1933“ die Gunst der Stunde, indem es die Kunst des Jahresregenten Strauss, das heißt also seine Musik, mit Exponaten seiner Tanzplakatsammlung in Zusammenhang bringt! In der kleinen aber umso feineren Ausstellung werden Vertreterinnen der Wiener Tanzmoderne gezeigt, deren oft rauschhafte Kunst sich (auch) in der neuen Interpretation von Walzern manifestierte. Der Walzer stellte dabei zuweilen eine Brücke zwischen der traditionellen Funktion der Musik im Tanz des 19. Jahrhunderts und seiner neuen Aufgabe in der Tanzmoderne dar.
Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) nützt in seiner Ausstellung „Johann Strauss: Rausch und Ekstase. Feministischer Ausdruckstanz im Plakat 1900–1933“ die Gunst der Stunde, indem es die Kunst des Jahresregenten Strauss, das heißt also seine Musik, mit Exponaten seiner Tanzplakatsammlung in Zusammenhang bringt! In der kleinen aber umso feineren Ausstellung werden Vertreterinnen der Wiener Tanzmoderne gezeigt, deren oft rauschhafte Kunst sich (auch) in der neuen Interpretation von Walzern manifestierte. Der Walzer stellte dabei zuweilen eine Brücke zwischen der traditionellen Funktion der Musik im Tanz des 19. Jahrhunderts und seiner neuen Aufgabe in der Tanzmoderne dar.
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
![]() Hat man die Absicht, sich dem „Venusberg-Bacchanal“ in „Tannhäuser“ (Paris 1861) aus balletthistorischer Sicht zu nähern, sieht man sich unversehens einer vielarmigen Hydra gegenüber. Jeder Arm des Monsters vertritt eine der so verschieden ausgerichteten Interessensgruppen in Sachen des Komponisten Richard Wagner. Hat man sich einmal mit einiger Mühe zwischen Skylla und Charybdis der Sachlage – um eine weitere Metapher der griechischen Mythologie zu bemühen – durchgekämpft, kommt man zu der doch überraschenden Erkenntnis: Nicht nur haben sich fast alle namhaften ChoreografInnen mit dieser Ballettszene auseinandergesetzt, deren Aneinanderreihung ergibt auch ein Panorama der so verschiedenen ästhetischen und stilistischen Tanzrichtungen von mehr als 160 Jahren!
Hat man die Absicht, sich dem „Venusberg-Bacchanal“ in „Tannhäuser“ (Paris 1861) aus balletthistorischer Sicht zu nähern, sieht man sich unversehens einer vielarmigen Hydra gegenüber. Jeder Arm des Monsters vertritt eine der so verschieden ausgerichteten Interessensgruppen in Sachen des Komponisten Richard Wagner. Hat man sich einmal mit einiger Mühe zwischen Skylla und Charybdis der Sachlage – um eine weitere Metapher der griechischen Mythologie zu bemühen – durchgekämpft, kommt man zu der doch überraschenden Erkenntnis: Nicht nur haben sich fast alle namhaften ChoreografInnen mit dieser Ballettszene auseinandergesetzt, deren Aneinanderreihung ergibt auch ein Panorama der so verschiedenen ästhetischen und stilistischen Tanzrichtungen von mehr als 160 Jahren!
- Hauptkategorie: Wiener Tanzgeschichten
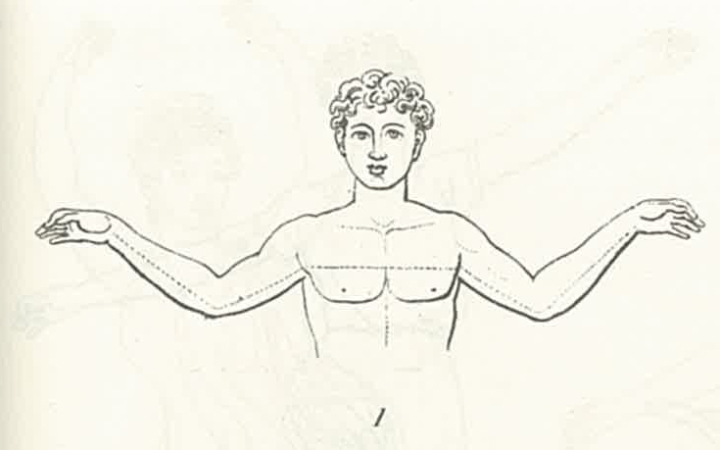 Am 15. Mai 2015 erschien in diesem Medium die erste Ausgabe der „Wiener Tanzgeschichten“. Gedacht als ein in loser Folge erscheinendes Format, sollte und soll es auch weiterhin an Ereignisse in der Wiener Tanzlandschaft erinnern. Die Absicht für die Reihe war, die enorme Vielfalt des Bestehenden sowie des Tradierten aufzuzeigen, historische Entwicklungen zu durchleuchten, darin Tradiertes im jeweiligen Neuen herauszufiltern, zudem aus dem Alten das Neue herauszulösen. Dies galt vor allem dann, wenn in zeitgenössischen Werken Spuren der so erfolgreichen, von den Nationalsozialisten weitgehend ausgelöschten Wiener Tanzmoderne zu finden sind.
Am 15. Mai 2015 erschien in diesem Medium die erste Ausgabe der „Wiener Tanzgeschichten“. Gedacht als ein in loser Folge erscheinendes Format, sollte und soll es auch weiterhin an Ereignisse in der Wiener Tanzlandschaft erinnern. Die Absicht für die Reihe war, die enorme Vielfalt des Bestehenden sowie des Tradierten aufzuzeigen, historische Entwicklungen zu durchleuchten, darin Tradiertes im jeweiligen Neuen herauszufiltern, zudem aus dem Alten das Neue herauszulösen. Dies galt vor allem dann, wenn in zeitgenössischen Werken Spuren der so erfolgreichen, von den Nationalsozialisten weitgehend ausgelöschten Wiener Tanzmoderne zu finden sind.